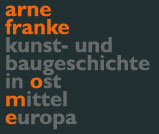Ein zweites „Schlesisches Elysium“ ?
Archiv 2024
Die ehemalige Grafschaft Glatz, im Mittelalter Zankapfel zwischen dem piastischen Polen und dem Herrschaftsgebiet der böhmischen Přemysliden, wurde mit dem Glatzer Pfingstfrieden 1137 Bestandteil des Königsreichs Böhmen und ging mit diesem 1526 in die Hände des Habsburgerreiches über. Mit der Eroberung Schlesiens durch König Friedrich II. wurde das Bergland 1763 endgültig der preußischen Provinz Schlesien angeschlossen.
Schon
im 19. Jahrhundert durch seine zahlreichen Heilbäder als „Gesundbrunnen
Deutschlands“ überregional bekannt, prägten jedoch von jeher mehr als
achtzig Adelssitze mit zum Teil weitläufigen Parkanlagen diese
Kulturlandschaft. Mit ihren Wirtschaftshöfen waren sie zugleich
ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle Bezugspunkte für die
ländliche Bevölkerung.
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dem
Übergang Schlesiens an Polen und dem damit verbundenen
Bevölkerungsaustausch wurde dieser historischen Kontinuität eine Zäsur
gesetzt, die sich auch im Umgang mit den Schlösser und Herrenhäuser
niederschlug. Viele dieser, soweit sie nicht durch staatliche
Einrichtungen weitergenutzt wurden, verfielen in der Folgezeit zu
Ruinen.
Mit der politischen Wende in Osteuropa erfolgte jedoch eine deutliche Kehrtwendung, die diesem gemeinsamen kulturellen Erbe von Deutschen und Polen wieder neue Überlebenschancen eröffnet.
Die in diesem Vortrag vorgestellten Revitalisierungsprojekte zahlreicher Adelssitze, darunter der Schlösser Grafenort/Gorzanów, Scharfeneck/Sarny oder des Herrenhauses von Kamnitz/Kamieniec zeigen, dass diese reiche, malerisch von den Sudeten umrahmte Kulturlandschaft zukünftig durchaus mit dem „Schlesischen Elysium“, dem Hirschberger Tal am Rande des Riesengebirges konkurrieren kann.
Im Juni 2024 wird dazu eine mehrtägige Studienreise angeboten. Nährere Informationen dazu hier.
Veranstaltungsort
Haus Schlesien
Dollendorfer Str. 412
53639 Königswinter
Tel.: 02244-8860