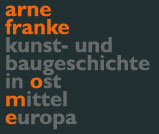Erkundung einer „terra incognita“
Archiv
Reiseziel in den Jahren 2016, 2017, 2024
Die etwa 100 Kilometer östlich Berlins sich erstreckende Neumark, jenseits der Oder und damit seit 1945 in Polen liegend, ist mit seiner reichen Kulturgeschichte sowohl für Polen als für Deutsche zumeist eine völlige „terra incognita“.
Die im Mittelalter als „terra transoderana“ bezeichnete, dünn von Slawen besiedelte Region stand zunächst unter der Herrschaft der polnischen bzw. schlesischen Piasten. Deren Besiedlungspolitik zog ab dem 12. Jahrhundert zunehmend deutsche Kolonisten in das Land, für die Städte, Dörfer und Klöster gegründet wurden. Zudem kam das Gebiet zunehmend unter den Einfluss Brandenburgs, dessen östliche Grenzmark es ab Mitte des 13. Jahrhunderts wurde. Seither teilte das Land weitgehend das Schicksal von Altmark und Mittelmark, wurde mit dem 14. Jahrhundert integraler Bestandteil des Kurfürstentums, ab 1701 Provinz des Königreichs Preußen und verlor den Namen Neumark schließlich, nachdem die Region 1815 in der neu eingerichteten Provinz Brandenburg aufging.
Mit dem Zweiten Weltkrieg wurden viele der Städte und Dörfer, die unmittelbar in der Hauptkampflinie östlich von Berlin lagen, wie beispielsweise die alte Residenzstadt Küsterin/Kostrzyn, schwer zerstört – nach dem Fall an Polen im August 1945 und der Vertreibung der deutschen Bevölkerung versank die Region hinter dem „Eisernen Vorhang“ in nahezu völliger Bedeutungslosigkeit.
Seit der politischen Wende in Ostmitteleuropa erfreuen sich die heutigen Polen gelegen Ostprovinzen Deutschlands einer wachsenden Beliebtheit bei deutschen Kulturtouristen. Doch nachdem Ost- und Westpreußen, Schlesien und auch Hinterpommern längst seine Liebhaber gefunden haben, fristet die Neumark – zu Unrecht – noch immer ein Schattendasein.
Diese Studienreise begibt sich nun auf die Spurensuche der wechselvollen Geschichte und ergründet diese anhand seines architektonischen Erbes, das mit großartigen Stadt- und Dorfkirchen, wie der im Wiederaufbau begriffenen Marienkirche von Königsberg/Chojna oder der ehemaligen Wallfahrtskirche in Brietzig/Brzesko, eindrucksvollen Adelssitzen, wie der einstigen Johanniter-Burganlage in Lagow/Łagów, des klassizistischen Schlosses von Prillwitz/Przelewice, des Neuen Schlosses in Königswalde/Lubniewice oder des exzellent restaurierten neugotischen Schlosses von Merenthin/Mierzęcin. Daneben waren es auch die geistlichen Orden, die sich bei der Erschließung des Landes verdient gemacht haben, ob nun die Zisterzienser des heute exzellent restaurierten Klosters von Paradies/Gościkowo oder die Ordensritter der Johanniter, die in Sonnenburg/Słońsk ihren Balleisitz hatten.
Neben gut erhaltenen und restaurierten Bauwerken werden wir auf dieser Reise u. a. am Beispiel des Schlosses Dölzig/Dolsk, der ehemaligen Hohenzollernresidenz in Wildenbruch/Swobnica oder des Fachwerkgutshauses von Niepölzig/Niepołcko einige erstaunliche Wiederaufbauprojekte kennenlernen, die das zunehmende Engagement der polnischen Nachbarn für das gemeinsame Kulturerbe von Deutschen und Polen belegen.
Als Logis haben wir die zu komfortablen Hotels adaptierten Schlösser Waitzen/Wiejce und Mehrenthin/Mierzęcin zur Verfügung.

Lagow/Łagów | Neben der gut erhaltenen Burganlage ist auch das am See gelegene Städtchen sehenswert, in dem sich die Vorburg mit Toranlage und einige Fachwerkhäuser erhalten haben. 
Paradies/Gościkowo | Im Innern der barockisierten Klosterkirche sind – u. a. nach aufwändigen Freilegungen – noch etliche Details des nach wie vor erhaltenen gotischen Baukörpers erhalten, wie beispielsweise die schlichten Kreuzrippengewölbe. Ebenfalls zeit- und ordenstypisch sind die Abkragungen der Gewölbedienste, die als Wandvorlagen durch gotische Konsolen abgefangen werden. 
Lagow/Łagów | Durch die brandenburgischen Askanier als Grenzburg zum piastischen Großpolen gegründet, ging die Anlage 1350 an den Johanniterorden, der die heutige Ordensburg errichtete. Ende des 17. Jahrhunderts in Teilen barockisiert, überstand die Gesamtanlage die Zeiten bis heute ohne gravierende architektonische Eingriffe. Charakteristisch für die Ordenssitze der Johanniter ist der im oberen Teil zylindrisch ausgeformte Bergfried, der zu den ältesten Teilen der Gesamtanlage zählt. 
Königswalde/Lubniewice | Im malerisch am Lübbens-See gelegenen Städtchen gibt es gleich zwei Schlösser. Das ältere, ein Bau des Klassizismus, befindet sich jedoch in einem sehr verwahrlostem Zustand. Das Neue Schloss, Ende des 19. Jahrhunderts durch die Familie von Waldow-Reitzenstein errichtet und 1909 durch einen markanten Turm den Seeflügel im Reformstil nach Entwürfen des Architekturbüros Dinklage, Paulus und Lilloe erweitert, ist heute im Besitz eines Vertreters des polnischen Hochadels, der es seit Jahren restauriert und als Sommerresidenz nutzt. 
Waitze/Wiejce | Das nahe des Ufers der Warthe/Warta gelegene Schloss, bis 1945 im Besitz der Familie von Bennigsen, wurde in den letzten Jahren aufwändig renoviert und zu einem Schlosshotel adaptiert. 
Sonnenburg/Słońsk | Im Innern der Johanniterkirche dominiert das zwischen 1520 und 1522 errichtete Stenrgewölbe, dessen originale Fassung seit den 1990er Jahren restauriert wurde. 
Sonnenburg/Słońsk | Nur eine traurige Ruine (Foto von 2014) blieb von dem einst prächtigen Balleisitz des Johanniterordens. Das Schloss, das zu den bedeutendsten frühbarocken Herrensitzen in Brandenburg zählte, brannte 1975 völlig aus. Jüngst jedoch wurde die Ruine baulich gesichert und für eine öffentliche Nutzung vorbereitet. 
Tamsel/Dąbroszyn | Das heutige Schloss, 1851 neogotisch überformt, geht auf einen Barockbau der Familie von Schönig zurück. Der seit Jahren verwaiste, mehrmals zum Verkauf angebotene Bau war im 18. Jahrhundert ein bekannter Musenhof, in dem auch der spätere preußische König Friedrich der Große häufig zu Gast war. 
Marienwalde/Bierzwnik | Große Teile der gotischen Konventsgebäude einschließlich Teilen des Kreuzganges sind bis heute erhalten und werden sukzessive restauriert. Hier rechts der Eingang zum ehemaligen Refektrorium. 
Mehrenthin/Mierzęcin | Das exzellent restaurierte neogotische Schloss wird eines der noblen Quartiere auf dieser Studienreise sein. 
Niepölzig/Niepołcko | Das Gebäude zählt zu den wenigen noch erhaltenen Sichtfachwerk-Gutshäusern östlich der Oder. Der nach 1717 errichtete Vorgängerbau wurde Ende des 18. Jahrhunderts durch die Familie von Waldow durch den heutigen Bau ersetzt. Nach 1945 als Unterkunft für „Repatrianten“ genutzt, zerfiel das Haus seit den 1990er Jahren zu einer völligen Ruine, konnte aber durch das Engagement einer polnischen Privatinitiative gerettet und mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland renoviert werden. 
Prillwitz/Przelewice | Das klassizistische Schloss ließ der Geheime Finanzrat August Heinrich von Borgstede um 1800 errichten. Für den Entwurf des eleganten Adelssitzes wird der Berliner Architekt Heinrich Gentz angenommen 
Prillwitz/Przelewice | Zum gleichnamigen Schloss gehört ein weitläufiges Arboretum mit einem frühen japanischen Garten, der durch den damaligen Eigentümer der Anlage, Conrad von Borsig in Zusammenarbeit mit der Berliner Späth´schen Baumschule angelegt wurde. 
Dölzig/Dolsk | Der in der Neumark gelegene, 1845 errichtete Adelssitz – bis 1945 im Besitz der Familie von Tresckow – verkam nach 1945 zu einer völligen Ruine, von der lediglich die Außenwände erhalten waren. Durch eine deutsch-polnische Familie erworben, wurde das Schloss aufwändig rekonstruiert – die Aufnahme zeigt den Zustand 2015. 
Wildenbruch/Swobnica | Die Schlossanlage einer Nebenlinie der Hohenzollern, deren markanter zylindrische Wehrturm noch den Ursprung als Johanniter-Ordensburg zurückgeht, wurde nach dem Verkauf der Anlage an die Gemeinde Banie (Bahn) baulich gesichert. Seither sind die wertvollen frühbarocken Stuckdecken im Schloss zumindest nicht mehr akut gefährdet. Eine Gesamtinstandsetzung der Anlage steht jedoch nach wie aus. 
Zehden/Cedynia | Das Ende des 13. Jahrhunderts unweit der Oder gegründete ehemalige Zisterzienserinnenkloster wurde mit der Reformation eine kurfürstlich-brandenburgische Domäne. Zu ende des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt, wurde der Westflügel mit dem einstigen Refektorium und dem darüberliegenden Dormitorium zu einem Hotel ausgebaut. 
Küstrin/Kostrzyn nad Odrą | Die einstige Festungsstadt, am Zusammenfluss von Oder/Odra und Warthe/Warta u. a. durch den Deutschen Orden entwickelt und im 16. Jahrhundert Hauptstadt des kurzlebigen Markgraftums Neumark wurde bei den Endkämpfen 1945 nahezu völlig zerstört. Danach verwildet und zugewachsen, wird das Zentrum der einstigen Stadt seit den 1990er Jahren ausgegraben und bietet einen spannenden Geschichtspfad. 
Königsberg/Chojna | Der mit einem markanten Staffelgiebel ausgestattete Rathausbau geht auf das frühe 14. Jahrhundert zurück und wurde vermutlich – wie die Marienkirche – durch den Baumeister Hinrich Brunsberg vollendet. Nach Kriegszerstörungen wiederaufgebaut, beherrscht das einst von Häusern umgebene Gebäude den großen Marktplatz.