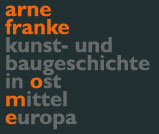Schlösser und Residenzen im nördlichen Schlesien
Archiv
Reiseziel im Jahr 2023
Mit mehr als 3.000 Schlössern und Herrenhäusern weist Schlesien die größte Dichte an Adelssitzen in Europa auf. Ein Teil dieser hat die Zeit des Zweiten Weltkriegs – zumindest was das äußere Erscheinungsbild anbelangt – ebenso überstanden wie nahezu 45 Jahre Sozialismus. Zwar sind heute sehr viele dieser kulturgeschichtlich bedeutendswerten Ensembles in beklagenswertem Zustand, doch etliche konnten in den letzten 25 Jahren vorzüglich restauriert werden.
Auf dieser Studienreise erkunden Sie neben einigen der bekanntesten Schlossanlagen auch weitgehend unbekannte, aber kunstgeschichtlich bedeutende Schlösser, deren heutiger Erhaltungszustand die wechselnden Zeitläufte seit Mitte des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Die Reise führt zunächst in die „Ziemia Lubuska“, das nach 1945 als „Lebuser Land“ bezeichnete nördliche Schlesien, in dem in den letzten Jahren einige bemerkenswerte Renovierungsprojekte von Adelssitzen durch Kommunen, aber auch private Initiativen ins Leben gerufen wurden – so beispielsweise die Restaurierung des Schlosses Boyadel/Bojadła oder die Revitalisierung der Schlossanlage des südlich von Grünberg/Zielona Góra gelegenen Günthersdorf/Zatonie mit einem wiederhergestellten Park von Peter Joseph Lenné. Zudem steht die in Restaurierung begriffene Barockresidenz der Grafen von Hochberg in Rohnstock/Roztoka und das Renaissanceschloss in Adelsdorf/Struga auf dem Programm.
Neben den historischen Adelssitzen stehen auch ausgewählte Sakralbauten im Fokus dieser Reise. Sie reflektieren die wechselvolle Religionsgeschichte des Oderlandes bis in das 18. Jahrhundert. So werden Sie auch die faszinierende, als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnete Friedenskirche von Jauer/Jawor besichtigen.
Begegnungen mit Schlosseigentümern und den Protagonisten einiger Denkmalinitiativen zur Rettung des deutsch-polnischen Kulturerbes runden das vielfältige Programm ab.

Wichelsdorf/Wiechlice | Das zwischen 1790 und 1795 errichtete spätbarocke Schloss wurde 2007 an einen polnischen Privatmann verkauft, der es seit aufwändiger Restaurierung als komfortables Schlosshotel führt. 
Boyadel/Bojadła | Seit mehr als 20 Jahren leerstehend, wurde das Barockschloss weitgehend devastiert, aber inzwischen durch eine polnische Familie behutsam restauriert. 
Carolath/Siedlisko | Die bedeutende, im späten 19. jahrhundert stark erweiterte Renaissanceresidenz der Fürsten von Schönaich-Carolath wurde während des Zweiten Weltkriegs weitgehend zerstört. Erhalten blieben eindrucksvolle Ruinen der Anlage sowie das Torhaus mit der dahinterliegenden Schlosskapelle. 
Carolath/Siedlisko | Die bedeutende, im späten 19. jahrhundert stark erweiterte Renaissanceresidenz der Fürsten von Schönaich-Carolath wurde während des Zweiten Weltkriegs weitgehend zerstört. Erhalten blieben eindrucksvolle Ruinen der Anlage sowie das Torhaus mit der dahinterliegenden Schlosskapelle. 
Carolath/Siedlisko | Ausgesprochen eindrucksvoll war die „Sala terrena“, der manieristische Gartensaal gestaltet, von dem nach der Zerstörung 1945 die nun wieder aufgestellten Säulen und einige restaurierte Wanddekorationen zeugen 
Carolath/Siedlisko | Mit der 1618 durch Valentin von Säbisch errichteten, im Zweiten Weltkrieg unzerstört gebliebenen reformierten Schlosskapelle ist einer der bedeutendsten protestantischen Sakralbauten Schlesiens erhalten geblieben. 
Günthersdorf/Zatonie | Das 1945 bei Kriegshandlungen ausgebrannte Schloss geht auf einen Barockbau aus dem Ende des 17. Jahrhunderts zurück. 1842 im Auftrag der aus einer baltischen Adelsfamilie stammenden Dorothea von Biron, Herzogin von Sagan/Żagań klassizistisch überformt, geht dessen Entwurf auf einen Baumeister aus dem Umkreis Karl Friedrich Schinkels zurück. Die Ruine wurde 2018 aufwändig gegen weiteren Zerfall gesichert und mit einem spektakulären Beleuchtungssystem ausgestattet, ebenso wurde der Peter Joseph Lenné zugeschriebene Park umfassend revitalisiert 
Jauer/Jawor | Einer der eindrucksvollsten evangelisch-lutherischen Sakralbauten Schlesiens ist die Friedenskirche, die als architektonische Landmarke die Widerstandskraft der während der Habsburger Herrschaft über Schlesien unterdrückten Konfession verdeutlicht. 
Jauer/Jawor | Die nun lediglich mit Holz, Stroh und Lehm innerhalb eines Jahres errichtete Fachwerkkirche überstand alle weiteren Kriege, ist noch heute ein evangelisch-lutherisches Gotteshaus und steht seit 2001 unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes. 
Rohnstock/Roztoka | Der auf einer spätmittelalterlichen Wasserburg basierende barocke Schlossbau befand sich zwischen 1497 und 1945 im Besitz eines Familienzweiges der Grafen von Hochberg auf Fürstenstein. Die von Felix Anton Hammerschmidt konzipierte Vierflügelanlage wurde in den 1870er Jahren durch zusätzlichen architektonischen Schmuck repräsentativ überformt. 
Adelsbach/Struga | Die Schlossanlage, die aus einem mittelalterlichen Wohnturm hervorgeht, war bis in die 1990er Jahre eine völlige Ruine geworden, bis sie ein polnisches Ehepaar übernahm, die in beeindruckender Weise das Bauwerk behutsam renoviert. Dabei konnten sie einen der spektakulärsten Zyklen an renaissancezeitlichen Wandmalereien aufdecken und restaurieren. 
Adelsbach/Struga | Die bis auf einen mittelalterlichen Wohnturm zurückgehende Schlossanlage von Adelsbach birgt einen nahezu einmaligen, jüngst entdeckten Schatz: nahezu 20 renaissancezeitliche Portraits römisch-deutscher Kaiser − Wandmalereien, die sich gerade in Restaurierung befinden.
Literaturhinweise:
Arne Franke (Hg.)
„Kleine Kulturgeschichte der schlesischen Schlösser”